Zietenhusar
(Hausmeister)


|
Nachtrag, entsprechende Angaben aus zeitgenössischen Quellen, in für das Thema ausführlicherer, aber stark geraffter Version.
Gebrauchsmuster.
Der deutsche Gebrauchsmusterschutz gründet sich auf das Gesetz vom 1. Juni 1891, das am 1. Oktober 1891 in Kraft getreten ist. Das Gebrauchsmusterrecht gehört neben dem der Muster und Modelle (Gesetz vom 11. Januar 1876) und der Patente (Gesetz vom 7. April 1891) zu dem eigentlichen gewerblichen Urheberrecht. Die Gegenstände des Gebrauchsmusterschutzes sind regelmäßig gegenüber den Mustern und Modellen (Geschmacksmustern) abgegrenzt, nämlich hinsichtlich der Zweckbestimmung der Muster. Die Neuerungen der Geschmacksmuster sollen auf den Schönheitssinn, die der Gebrauchsmuster dagegen auf den Gebrauch hinzielen oder berechnet sein. Den Patenten gegenüber aber ist gleichfalls eine wenn auch weniger scharfe Grenze gezogen, indem einmal für gewisse Erfindungen der Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist, anderseits die sogenannten kleinen Erfindungen das eigentliche Feld der Gebrauchsmuster bilden sollen.
Gemäß § 1 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes sollen Modelle von Arbeitsgerätschaften oder Gebrauchsgegenständen oder von deren Teilen als Gebrauchsmuster geschützt werden, insoweit sie dem Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung, Anordnung oder Vorrichtung zu dienen haben. Die seit Bestehen des Gesetzes gesammelten Erfahrungen zeigen, daß einerseits Verfahren, also Herstellungs- und Arbeitsweisen jeglicher Art des Gebrauchsmusterschutzes unfähig sind, anderseits Maschinen verwickelter Bauart größeren Umfangs sowie unbewegliche Teile von Bauwerken, ferner solche Anordnungen, deren Neuheit in der Flächenmusterung besteht oder in der Benutzung andern Stoffes. Nur in Ausnahmefällen ist die Schutzberechtigung für den Ersatz eines Stoffes durch einen andern anerkannt worden.
[…]
Eine Prüfung des angemeldeten Modelles auf Neuheit und Schutzberechtigung steht der eintragenden Behörde, der Anmeldestelle für Gebrauchsmuster des Kaiserlichen Patentamts, nicht zu. Diese sorgt nur dafür, daß den formellen Anforderungen des Gesetzes sowie den über die Anmeldung von Gebrauchsmustern erlassenen Bestimmungen nebst Erläuterungen vom 22. November 1898, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen, 4. Jahrgang, 1898, S. 228, Genüge geschieht. Über die Grundsätze, nach denen das Amt im allgemeinen verfährt, geben die Mitteilungen der Anmeldestelle für Gebrauchsmuster a.a.O., 1. Jahrgang, 1894–95, S. 152, der Präsidialbescheid vom 25. Februar 1902, a.a.O., 8. Jahrgang, 1902, S. 119, sowie der Bericht über »Die Geschäftstätigkeit des Kaiserlichen Patentamts« im Jahre 1902, S. 217, Aufschluß, insbesondere über die Fragen der Einheitlichkeit und zulässigen Änderungen der Unterlagen der Priorität, der Bezeichnung.
Die Anmeldung eines Modelles hat schriftlich zu erfolgen, wobei eine Nachbildung des Modelles oder eine doppelt angefertigte Abbildung beizufügen ist. Die gesetzliche Gebühr von 15 M. ist an die Patentamtskasse zu entrichten.
[…]
Der Forderung des Gesetzes, die Anmeldung solle angeben, welche neue Gestaltung oder Vorrichtung dem Arbeits- oder Gebrauchszweck dienen soll, wird zweckmäßig durch Aufstellung eines Schutzanspruches ähnlich einem Patentansprüche nachgekommen. Hierbei ist zu beachten, daß das Patentamt bei der Fassung nicht mitzuwirken in der Lage ist, daß also der Anmelder oder sein Vertreter die wesentlichen Merkmale der Neuerung so einwandfrei wie möglich zusammenzufassen haben, weil diese Angabe für den Umfang des aus der Eintragung folgenden Rechtsschutzes von großer Bedeutung ist. Da im Gegensatz zu Patenten Gebrauchsmuster bestimmte Modelle und nicht eigentliche, einer mannigfaltigen Verkörperung fähige Erfindungen schützen, ist jedes Modell nur durch einen einzigen Anspruch zu kennzeichnen; sind mehrere Ansprüche aufgestellt, so werden bei Feststellung des geschützten Modelles deren Merkmale zusammenzufassen sein. […]
Das Gebrauchsmusterrecht ist vererblich und beschränkt oder unbeschränkt durch Vertrag oder Verfügung von Todes wegen übertragbar, außerdem im Lizenzwege verwertbar. Der Schutz des Gebrauchsmusters erlischt, wenn der Eingetragene den Verzicht auf den Schutz erklärt oder wenn nach Ablauf der ersten dreijährigen Schutzfrist nicht die Verlängerung auf weitere drei Jahre durch Zahlung der Gebühr von 60 M. bewirkt ist. Eine nochmalige Verlängerung ist nicht zulässig, so daß die längste Dauer des Gebrauchsmusters 6 Jahre beträgt.
[…]
Literatur: Kommentare von Seligsohn, 3. Aufl., Berlin 1906, Allfeld 1904, Isay 1903; Neuberg, J., Der internationale gewerbliche Rechtsschutz, Leipzig 1905.
Hans Heimann in "Otto Lueger; Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften" Band 4, Stuttgart & Leipzig 1906.
Urheberrecht.
Der deutsche Urheberschutz gründet sich auf die folgenden drei Gesetze: 1. Gesetz vom 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen [...]
1. Unter das Urheberrecht an Mustern und Modellen fallen die sogenannten Geschmacksmuster: gewerbliche Muster oder Modelle, Industrieerzeugnisse, wobei Neuheit und Eigentümlichkeit Voraussetzung für die Schutzberechtigung bilden. Zweck der Neuerung muß die Anregung des Formensinnes, die Wirkung auf den Geschmack sein, z.B. die Gestaltung eines Knopfes, das Muster eines Stoffes, die Form einer Schnalle, wobei die Verwendbarkeit, der Gebrauch, praktisch nicht wesentlich ist, ohne daß es allerdings ausgeschlossen wäre, daß die geschmackvolle Form auch den Gebrauch fördert. – Der Schutz besteht in dem Recht des Verbietens unbefugter Nachbildung des Musters oder Modelles zum Zweck der Verbreitung. Der Schutz ist von der Anmeldung zur Eintragung in das Musterregister abhängig und steht nur dem Urheber zu, wobei die von Angestellten gefertigten Muster oder Modelle dem Inhaber der betreffenden Anstalt zukommen, falls nicht das Gegenteil ausdrücklich vereinbart ist. Im übrigen gilt der Anmelder bis zum Gegenbeweise als Urheber.
[…]
Die Eintragung der Muster ist nicht zentralisiert; sie erfolgt durch die Gerichtsbehörden, und zwar durch die Amtsgerichte, und hier haben die Anmeldungen zu erfolgen. Wichtig ist die richtige Wahl der zuständigen Gerichtsbehörden, da sonst die Rechtskraft gefährdet erscheint. [...] – Die Eintragungen sind seitens der Gerichtsbehörde zu bewirken, ohne daß ihr das Recht einer materiellen Prüfung zusteht, sobald die formellen Vorschriften erfüllt sind. Hierzu ist in erster Linie die Anmeldung in Gestalt des Antrags auf Eintragung mündlich oder schriftlich zu Protokoll und die Niederlegung in Gestalt eines Exemplars oder einer Abbildung des Musters und Modelles erforderlich, ferner die bestimmte Angabe, ob die Eintragung für Flächen- oder für plastische Erzeugnisse bestimmt ist. […] Bestimmungen über die Rechtsfolgen der widerrechtlichen Nachbildung oder Verbreitung enthält das Gesetz nicht: es verweist vielmehr auf das Gesetz vom 11. Juni 1870, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken usw., dessen Bestimmungen in Kraft bleiben, obgleich es durch Gesetz vom 19. Juni 1901 ersetzt worden ist.
[…]
Literatur: Dambach, O., Das Musterschutzgesetz vom 11. Januar 1876, Berlin 1876; Schmid, P., Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876, Berlin 1876; Derselbe, Die Entwicklung des Geschmacksmusterschutzes in Deutschland, Berlin 1876; Stephan, R., Gesetz vom 11. Januar 1876, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen, Berlin 1897; Schanze, O., Recht der Erfindungen und Muster, Leipzig 1899; Allfeld, Ph., Kommentar zum Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Mustern und Modellen vom 11. Januar 1876, München 1904; Kohler, J., Muster und Modelle, Berlin 1909; Derselbe, Das literarische und artistische Kunstwerk und sein Autorschutz, Stuttgart 1892; Allfeld, Ph., Die Reichsgesetze, betreffend das literarische artistische Urheberrecht, München 1893; Müller, Das deutsche Urheber- und Verlagsrecht, München 1901; Voigtländer, Die Gesetze, betreffend das Urheberrecht und das Verlagsrecht an Werken der Literatur und Tonkunst vom 19. Juni 1901, Leipzig 1901; Allfeld, Ph., Kommentar zu den Gesetzen vom 19. Juni 1901, München 1902; Kohler, J., Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, Stuttgart 1906; Mittelstaedt,. Das neue Kunstschutzgesetz, im sächsischen Archiv für Rechtspflege 1907; Osterrieth, Der Rechtsschutz des Kunstgewerbes nach dem neuen Kunstschutzgesetz, Werkkunst 1907; Derselbe, Das Urheberrecht an Werken der bild. Künste u. d. Photographie, Gesetz vom 9. Januar 1907; Daude, P., Das Reichsgesetz betr. das Urheberrecht der bild. Künste u. d. Photographie vom 9. Jan. 1907, Stuttgart 1907; Goldschmidt, K., Das Recht der Angestellten an ihren Erfindungen, Halle a. S. 1909.
Hans Heimann In "Otto Lueger; Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften", Band 8, Stuttgart & Leipzig 1910.
|
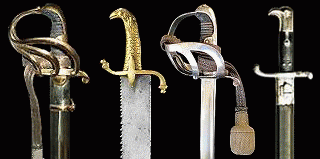
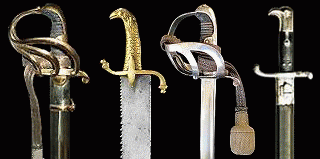
 27.03.09, 14:41:00
27.03.09, 14:41:00
 27.03.09, 14:43:01
27.03.09, 14:43:01
 28.03.09, 00:09:53
28.03.09, 00:09:53
 18.04.09, 07:29:11
18.04.09, 07:29:11
 18.04.09, 07:47:32
18.04.09, 07:47:32
 03.05.09, 07:24:27
03.05.09, 07:24:27
 05.10.10, 17:36:08
05.10.10, 17:36:08