Text & Bilder Rolf Selzer
Die Seitengewehre der Königlich Sächsischen Fußgendarmen
Die polizeilichen Aufgaben wurden im Königreich Sachsen von drei verschiedenen Behörden (einer kommunalen und zwei staatlichen) wahrgenommen.
Zum einen von der kommunalen Sicherheitspolizei (Gemeindepolizei bzw. Schutzmannschaft), die in den Städten von den Stadträten und auf dem platten Lande vom Amtshauptmann verwaltet wurde, zum anderen von der Königl. Sächs. Landgendarmerie. Bedingt durch die immer mehr zunehmende Unsicherheit auf dem Lande, wurde diese Formation nach franz. Vorbild 1809 gegründet. Ergänzt wurde die Gendarmerie aus ehemaligen Angehörigen der sächsischen Armee. Diese Gendarmen besaßen die "Staatsdienereigenschaft", d.h. nach heutigem Sprachgebrauch nichts anderes, als daß es sich dabei um Staatsbeamte handelte. Im Gegensatz zur preuß. Landgendarmerie waren die königl. sächs. Landgendarmen dem Ministerium des Inneren sowie disziplinarisch den Beamtengesetzen unterstellt und besaßen keinen Kombattantenstatus, d.h. sie waren nicht Angehörige des Soldatenstandes. Unabhängig davon war das Korps militärisch organisiert. Ab dem Jahre 1838 wurde zur Vereinheitlichung von Uniform, Ausrüstung und Bewaffnung eine zentrale Stelle, nämlich das Gendarmerie-Wirtschaftsdepot in Leipzig (ab 1850 Dresden) geschaffen. Das Korps wurde der wachsenden Einwohnerzahl auch personell angepaßt, so daß bei Beginn des 1. Weltkrieges ca. 500 Beamte vorhanden waren. Vervollständigt wurde die Landgendarmerie durch Spezialbranchen den Grenz-, Bahnhofs- und Forstgendarmen (1,2,3,4).
Als zweites staatliches Polizeiorgan bestand ab 1853 neben der Landgendarmerie das Stadtgendarmeriekorps in Dresden (3,12). Durch die Erfahrungen der deutschen Revolution von 1848 und mit Blick auf die Königliche Schutzmannschaft in Berlin (5) wurde die ehemals kommunale Polizei in eine staatliche umgewandelt. Der Grundgedanke war, in der Haupt- und Residenzstadt über eine loyale und mit 800 Beamten (3) auch personell starke Gendarmerie zu verfügen.
Für die kommunale Polizei läßt sich ein einheitliches Erscheinungsbild nicht nachweisen (12). Anders verhält es sich bei der Stadt- und Landgendarmerie. Die zentrale Versorgung der einzelnen Beamten durch das Gendarmerie-Wirtschaftsdepot führte unweigerlich zu einer Gleichförmigkeit in Uniform und Bewaffnung. Ein Einführungsjahr der Seitengewehre kann nur mit Vorbehalt angegeben werden. Die Polizeigeschichte (2) erwähnt einen für eine solche Seitenwaffe recht frühen Zeitpunkt: "Die Gendarmen erhielten 1839 Seitengewehre mit gerader Klinge, die von 1850 ab am Überschnallkoppel getragen wurden." Für das Jahr 1848 wird ein Polizeidiener der Stadt Dresden mit einer solchen Waffe gezeichnet (6). Deutlicher noch sind die Angaben zu den sächs. Zolluniformen (7), die als Bild 1 wiedergegeben sind. Das als Modell 1861 bezeichnete Seitengewehr scheint der Farbe nach zwar aus Messing gefertigt zu sein, die Form entspricht aber unverkennbar dem Polizei-Seitengewehr. Mila schreibt 1881 (8) über die Bewaffnung der unberittenen Brigadiers: "Stählerner Pallasch (sic) mit neusilbernem Bügel und Parierstange am Griff, dazu eine schwarze Lederscheide mit neusilbernem Mundstück und Ortband".
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Bewaffnung der Polizei Anfang der 20er Jahre. Zur Klarstellung: Bei den aufgeführten Waffen handelt es sich nicht um spezielle sächs. Dienstwaffen, die Angaben lassen sich auf alle staatliche Polizeieinheiten dieser Zeit übertragen! "Die Dienstwaffen der Polizeibeamten sind: nämlich Revolver, Pistole, Gewehr, ferner der Schlagring und für die in Zivil gehenden Beamten der Kriminal-, Sitten-, und politischen Polizei in der Regel der sogenannte Totschläger. Die Polizeibeamten dürfen die Schußwaffe nur bei Ausübung des Dienstes tragen, nicht außer Dienst. Die Schußwaffen sind geladen, aber gesichert zu tragen (12)." Trotz dieser für heutige Verhältnisse ungewöhnlicher Bewaffnung wurde die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt. "Die Schußwaffe darf nur angewendet werden, wenn die blanke Waffe unzureichend ist (12)."
Zum näheren Verständnis der Seitengewehre und einer Modellbezeichnung möge der Leser sich vor Augen führen, daß es sich nicht um Militär-Waffen, sondern um solche eines militärisch organisierten Gendarmerie-Korps handelt. Die Seitengewehre wurden bei Bedarf angekauft und verausgabt. Sie hatten einem bestimmten Muster zu entsprechen, ohne aber die bis auf den Millimeter gleiche Abmessung einer Militärwaffe zu besitzen. So sind auch die von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedlichen Fertigungen zu erklären: Trageknopf oder Tragehaken, unterschiedliche Scheidenbeschläge, Waffe verschraubt oder vernietet, mit oder ohne Federarretierung der Scheide, Wicklung zwei oder dreifach usw. Die Unterschiede sind von Modell zu Modell mehr oder weniger stark sichtbar. Vorgestellt werden hier die beiden typischen Modelle. Die Bezeichnung I und II wurde willkürlich gewählt und stellt keine Modellbezeichnung oder zeitliche Einordnung da!
Modell I Modell II
Länge mit Scheide 69,8 cm 73,8 cm
Länge ohne Scheide 69,2 cm 72,4 cm
Klingenlänge 56,0 cm 57,8 cm
Klingenbreite 2,5 cm 2,5 cm
Gewicht mit Scheide 775 g 880 g
Gewicht ohne Scheide 565 g 725 g
Modell I
Klinge: keilförmig, beidseitig mit Hohlkehle, kurze Fehlschärfe, Mittelspitze.
Gefäß: Neusilberne Griffkappe mit Griffring, Griffbügel und Parierstange mit Verstärkung sowie Rollknopf. Innen an der Parierstange eingelassen Sperrfeder mit Drücker. Griff mit Fischhaut und einer Oberwicklung aus drei verdrillten Silberdrähten. Nietkopf sichtbar.
Scheide: geschwärzte Lederscheide mit neusilbernem Mund- und Ortblech, Tragehaken, Aussparung am Deckplattenmundstück für die Feder.
Signaturen: Königskopf und Ritterhelm über W.K.&.C. als Herstellerzeichen der Firma Weyersberg, Kirschbaum & Co in Solingen auf der äußeren Fehlschärfe. Auf dem Klingenrücken eingeätzt der Händler: "MATTH. MÜLLER KGL. HOFL. LEIPZIG" sowie unter der vorderen Parierstange der "Truppenstempel": S.P.L.279
Modell II
Klinge: wie bei Modell I, aber mit längerer Fehlschärfe.
Gefäß: Neusilberne Griffkappe in Form eines Löwenkopfes mit der Angel verschraubt durch einen angedeuteten Nietknopf. Dieser zum leichteren Anziehen oder Lösen durchbohrt. Griffring, Griffbügel mit dem sächs. Wappenschild vorn im Bügel, Parierstange mit Rollknopf. Griff mit Fischhaut und Oberwicklung aus zwei verdrillten Messingdrähten.
Scheide: geschwärzte Lederscheide mit Neusilberbeschlägen, Trageknopf in Form einer Eichel.
Signaturen: Herstellerstempel P.D. LÜNESCHLOSS Solingen und Abnahmestempel in Form eines gekrönten gotischen Buchstabens sowie die Zahl 93 als Jahr der Übernahme in den Staatsärar 1893. "Truppenstempel" unter der vorderen Parierstange: S.P.D.421.
Die Modelle I und II stellen zwei typische Polizeiseitengewehre in Form und Farbe dar. Neusilber, Alpaka, Argentan usw. nennt man eine Legierung aus Nickel, Kupfer und Zink, die, u.a. wegen eines gefälligen Aussehens, gerne für Polizei- und Feuerwehrseitengewehre benutzt wurde.
Modell I mit dem Gefäß in der Form des preuß. Füsilier-Offizier-Säbels entspricht auch durch die Federarretierung einer Polizeiwaffe. Diese Art, eine Waffe in der Scheide zu sichern, wird in ihrem Zweck fast nie erklärt. Allein die österreichische Vorschrift (9) von 1852 für die Säbel der Gendarmerie liefert die Begründung: Die Sperrfeder mit Drücker sollte verhindern, daß dem Gendarmen im Handgemenge die Waffe entrissen wurde. Anscheinend hatte der eine oder andere Beamte die eigene Waffe zu spüren bekommen. Verschiedentlich tauchen auch Seitengewehre des Modells I auf, bei denen Sperrfeder und Drücker durch Ausfräsen entfernt und die Aussparung durch einen Neusilberkeil geschlossen wurde. Diese Sperrfeder läßt sich an Realstücken nicht nur wie bei der beschriebenen Waffe innen, sondern auch außen angebracht nachweisen. Das Modell II weicht als Polizei-Seitengewehr von dem fast international zu nennenden Modell I (ähnliche Waffen in Holland, Dänemark, Schweiz usw.) schon allein durch das sächs. Wappen im Bügel ab. Hier wurde durch die Formgebung eine unverwechselbar sächsische Waffe geschaffen. Waffen dieses Modells sind meist mit einer Abnahme versehen: vor 1918 mit gekröntem gotischen Buchstaben als Abnahmestempel und Jahreszahl (Bild 3) wie oben, danach wurde ein kleines sächs. Wappenschild ohne Krone gestempelt. Das Vorhandensein oder besser Nichtvorhandensein der Krone am Bügelwappen ist auch eines der Unterscheidungsmerkmale, ob die Waffe vor oder nach 1918 in Dienst gestellt wurde. Bei der hier beschriebenen Waffe wurde die Krone durch Ausfräsen entfernt (Bild 4). Nach dem ersten Weltkrieg, d.h. nach dem Erlöschen der Monarchie gefertigte Seitengewehre wurden bereits mit einem Bügelemblem ohne Krone ausgeliefert. Bezüglich des Entfernens des monarchischen Hoheitszeichens (Königskrone usw.) sei an dieser Stelle eine Verordnung aus dem "Ministerialblatt für die Sächsische innere Verwaltung" vom 15. Mai 1923 als Bild 5 wiedergegeben. In gleichem Sinne abgefaßte Verordnungen anderer Staaten führten auch zu den heute von vielen Sammlern nicht gewürdigten Militär- und Gendarmerie-Blankwaffen, bei denen teilweise der Korb zu einem einfachen Bügelgefäß abgefeilt wurde. Preußische I.O.D. 89 und sächsische I.O.S. 67 (Kammerstücke!) haben u.a. "den Preis dafür bezahlt".
Die beiden oben aufgeführten Seitengewehre stammen aus der Zeit vor 1918, die beiden Truppen- oder besser Polizeistempel aber danach. Auf eine formationstechnische Beschreibung der sächsischen staatlichen Polizei nach dem Weltkrieg wird verzichtet, die im Quellenverzeichnis angeführte Literatur wird den n„her in die Materie eindringenden Leser sicherlich weiterführen (13,14). Der Stempel S.P.D. (Bild 11) hat ebensowenig wie S.P.L. mit Politik zu tun, sondern steht mit der nachfolgenden Waffennummer für die Sicherheits- und ab 1920 Schutzpolizei (13) beim Polizeipräsidium Dresden bzw. Leipzig, sowie der nachfolgenden Waffennummer.
Geführt wurden beide Modelle bis in die 30er Jahre. Die Firmenkataloge einiger Blankwaffenhersteller weisen neben dem am 1. April 1930 eingeführten Polizei-Hirschfänger (10) auch die beiden sächs. Modelle auf (11).
Für ihre freundlicherweise erteilten Auskünfte sei den Herren Ingo Löhken und Wilfried Lüdeke herzlich gedankt. Bild 1 und 2 Historischer Bilderdienst Quenstedt.
Quellenangabe
1) Die Sächs. Landgendarmerie, erschienen im Selbstverlag der sächs. Staatspolizeiverwaltung ca. 1928.
2) Klahre - Die Geschichte des Königlich Sächsischen Landgendarmerie-Korps, Dresden 1909.
3) Die Organisation der Sächsischen staatlichen Polizei, Selbstverlag der sächs. Polizeiverwaltung ca. 1929.
4) K. Bühler - Schutzpolizei und Landesgendarmerie in Sachsen 1919-1933, Zeitschrift für Heereskunde 1984.
5) P. Schmidt - Die ersten 50 Jahre der Königlichen Schutzmannschaft zu Berlin, Berlin 1898.
6) Schoenfelder - Vom Werden der deutschen Polizei, Leipzig 1937.
7) G. Bräuer - Sächsischer Zoll, (Bild 1), ca. 1925.
8) A. Mila - Uniformierungs-Liste des Deutschen Reichs-Heeres etc. Berlin 1881.
9) F. Unteregger - Die Blankwaffen und deren Rüstungssorten im österreichischen Heer von 1860-1918, Gesellschaft für österr. Heereskunde 1979.
10) I. Löhken - Die Polizei-Uniformen in Preussen 1866-1945, Friedberg 1986.
11) F. Catella - Waffenfabrik Katalog, (Reprint div. Kataloge von 1920-1945) Straßburg 1986.
12) M. Weiß - Die Polizeischule, Dresden 1921.
13) G. Tessin - Deutsche Verbände und Truppen 1918-1939, Teil III. Die Landespolizei, Osnabrück 1974
14) [Georg] Maercker- Vom Kaiserheer zum Reichsheer,
Die Seitengewehre der Königlich Sächsischen Gendarmen zu Fuß. Deutsches Waffen-Journal, Jahrgang 27, Jahr 1991, Ausgabe 12, Seite 1828-1834
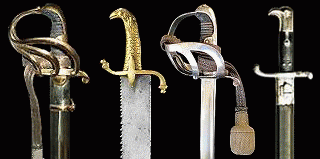
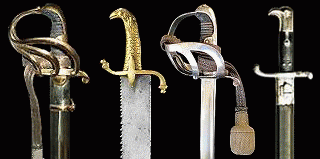
 15.11.16, 12:38:48
15.11.16, 12:38:48
 15.11.16, 12:49:04
15.11.16, 12:49:04
 15.11.16, 12:57:47
15.11.16, 12:57:47
 15.11.16, 14:26:55
15.11.16, 14:26:55
 15.11.16, 14:41:55
15.11.16, 14:41:55
 15.11.16, 14:54:49
15.11.16, 14:54:49
 15.11.16, 17:14:44
15.11.16, 17:14:44
 16.11.16, 00:57:57
16.11.16, 00:57:57
 16.11.16, 09:45:37
16.11.16, 09:45:37
 16.11.16, 10:51:48
16.11.16, 10:51:48